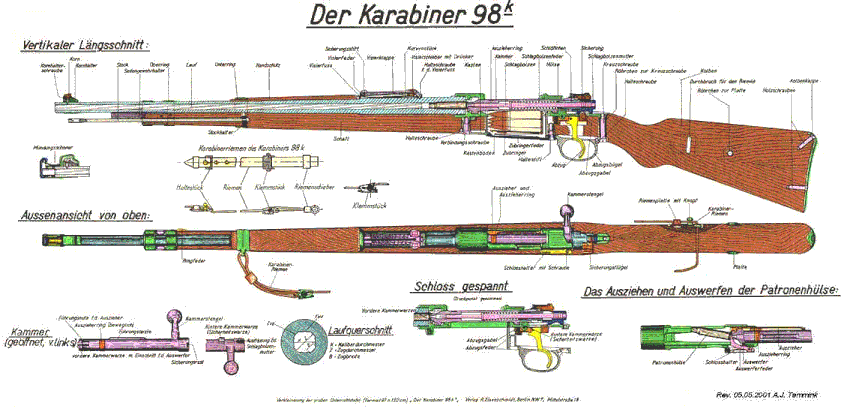Bewaffnung
Gardisten, Gefreite, Korporale und Zugsführer des Bürgerkorps tragen Gewehre vom Typ Mauser, Karabiner 98K. Die Karabiner haben Gewehrriemen, deren Länge individuell für jedes Korpsmitglied eingestellt ist.

Offiziere und Portepeeträger tragen Säbel vom Typus eines K.u.K. Jägersäbels Modell 1861.

Die Bedeutung der Ehrensalve
Salven sind Zeichen des Friedens und werden zur Ehre Gottes, des Landesfürsten (heute Landeshauptmann) oder toter Kameraden abgegeben. Der Grundgedanke liegt darin, für diese Genannten niemals einen Schuss im Lauf zu haben.
Somit ist jeder Ehren- Salut eine eindringliche Mahnung zum Frieden, den wir ja alle als hohes Gut schätzen.
Als Folgerung gilt somit der entstehende Lärm auch als hörbare Abschreckung des Krieges.
Die Ehrensalven des Bürgerkorps werden nach einer festgelegten Kommandoreihenfolge abgefeuert. Es ist für die Bevölkerung ratsam, entsprechend vorbereitet zu sein, um weniger zu erschrecken.
Die Gewehre sind mit einem Querstift im Lauf versehen, sodass keine scharfe Munition geladen werden kann. Somit werden nur Platzpatronen verwendet.
Es tritt nur eine Druckwelle aus dem Gewehr aus, die allerdings nicht fahrlässig zu unterschätzen ist. Dass das nicht vorkommt, wird regelmäßiges Exerzieren durchgeführt.
Jägersäbel

Der Säbel - zur Gruppe der Hieb– und Stichwaffen gehörend – ist eine seit dem 15. Jahrhundert in Europa gebräuchliche Blankwaffe. Ursprünglich wurde er als Hiebmesser bezeichnet, später setzte sich die aus Frankreich stammende Bezeichnung "Säbel" allgemein durch. Zunächst war der europäische Säbel vor allem eine Waffe des Bürgertums, die später auch vom Adel übernommen wurde. Als Vorläufer des europäischen Säbeltyps kann der vom Schwert abstammende Pallasch bezeichnet werden. Dieser weist - wie der Säbel - eine einschneidige Klinge auf. Pallasche wurden vorzugsweise bei der "Schweren Reiterei" verwendet. Die Vorläufer des heutigen europäischen Säbeltyps stammen aus dem Orient. Es sind dies der persische "Shamshir" (Löwenschweif) sowie der türkische "Kilij" (sprich Kilidsch). Was diese Säbeltypen gemeinsam haben ist ihre charakteristische gebogene Klinge. Die Griffstücke enden in einem stark nach vorne gebogenen Knauf.
Bei den Balkanvölkern setzte sich im Laufe der Zeit ein weiterer Säbeltyp durch. Es ist dies der "Handschar", auch "Jatagan" genannt. Sein auffallender Griff hat dunkle Horn- oder Knochenschalen die sich am oberen Ende zu "Ohren" verbreitern. Seine Klingenführung weist eine leichte Wellenform auf. In der österreichischen Armee war er vor allem bei den serbischen Freikorps in Verwendung. Zunächst konnte sich der orientalische Säbel in unseren Breiten keine vorrangige Stellung unter den Blankwaffen erobern, da die schweren Reiter starke Plattenpanzerungen und widerstandsfähige Helme trugen. Anders verhielt es sich in jenen europäischen Ländern, die in kriegerische Auseinandersetzungen mit Völkern verwickelt waren, die schnelle Reitertruppen bevorzugten. Diesen, gleich einem Steppenwind angreifenden Völkern, musste eine gleichwertige Truppe mit gleichwertiger Bewaffnung entgegengestellt werden. Als exemplarisch für diese Entwicklung kann die Tatsache angeführt werden, dass die Ungarn aufgrund der türkischen Expansion den Säbel als allgemeine Bewaffnung für ihre Husarenregimenter einführten. Mit den Husaren begann der Siegeszug des Säbels in allen europäischen Armeen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die österreichische Armee mit einem einheitlichen Säbeltyp bewaffnet. Auch die Offiziere trugen ab diesem Zeitpunkt anstatt des Degens nunmehr den Säbel. Die Weiterentwicklung des Säbels unterlag jedoch auch modischen Strömungen. So verflachte sich die Biegung der Klinge bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts soweit, dass man von einer beinahe geraden Klingenführung sprechen kann. Dies ist auch in ursächlichem Zusammenhang mit der Entwicklung des Säbels hin zu einer reinen Kommandowaffe zu bewerten, da durch die Einführung des Seitengewehres (Bajonettes) jeder Infanterist ohnehin mit einer effizienten Hieb- und Stichwaffe ausgestattet war.
Säbel des Bürgerkorps Riedau
Der nunmehr bezogene Säbeltyp (siehe Abbildung oben) ist der Offizierssäbel der österreichischen Infanterie, Modell 1861. Die Klinge ist leicht gekrümmt und auf beiden Seiten gekehlt. Sein Gefäß besteht aus dem mit Leder überzogenen Griffstück, der Griffkappe, dem Vernietknauf, dem Griffbügel, der Parierstange sowie dem Hinterarm der Parierstange mit zwei Schlitzen für den Faustriemen (Portepee). Die eiserne Scheide hat ein Ringband mit einer Trageöse sowie ein weiteres Ringband mit einem starren Tragering.
MAUSER K98 Gewehr
Unterscheidung: nur durch kleine Merkmale: Kammerstengel, Riemenhalterung am Schaft , Ausziehkralle und Auszieher.
- Der Lauf: Äußerlich gebräunte Stahlrohre mit Mündung und Laufmundstück, oder Patronenlager (dort wird die Patrone zur Zündung gebracht)
- Der Verschluss: verschließt den Lauf und bewirkt die Zuführung und Entzündung der Patrone das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhülse nach dem Schuss. Teile: Hülse mit Schlosshalter Und Auswerfer, Schlossabzugseinrichtung und Kasten mit Mehrladeeinrichtung. Die Hülse nimmt das Schloss auf. In der Hülsenbrücke befindet sich oben die Führungsnute für die Führungsleiste der Kammer, links der Durchbruch für den Schlosshalter und den Auswerfer. Der Schlosshalter begrenzt mit dem Haltestollen die Rückwärtsbewegungen des Schlosses. Schlosshalter und Auswerfer sind durch die Schlosshaltschraube mit der Hülse beweglich verbunden und werden durch die Doppelfeder betätigt.
- Das Schloss: Teile Kammer, Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder, Schlösschen mit Druckbolzenfeder, Sicherung, Schlagbolzenmutter, Auszieher mit Auszieherring.
- Schaft und Hautschutz: Der Schaft verbindet zusammen mit dem Beschlag und Handschutz sämtliche Gewehrteile zu einem Ganzen, ermöglicht die Handhabung des Gewehrs und schütz den Lauf. Schaft: Kolben, Kolbenhals, Handschutz. Der Kolben dient zum Einziehen des Gewehres in die Schulter. Der Handschutz liegt über dem hinteren Teil des Laufes.
Genauere Beschreibung des Laufes: Der Verschluss besteht wie schon erwähnt aus mehreren Teilen, angefangen mit der Kammer, der Schlagbolzenfeder, dem Schlagbolzen, der Sicherung, dem Schlösschen und der Schlagbolzenmutter, sowie der Kammer mit dem Kammerstängel auf die Kammer aufgesetzt und dem durch einen beweglichen Ring festgehaltenen Auszieher. Alle Teile sind Präzisionsteile und passen genau zusammen und sind daher sehr empfindlich. (z.B. Bruch des Ausziehers und des Kammerstengels etc.) Durch das Schließen des Schlosses wird die oberste Patrone aus der Mehrladeeinrichtung in das Patronenlager geschoben und gleichzeitig durch Zusammendrücken die Schlagbolzenfeder gespannt. Beim zurückziehen des Abzugstollen durch den Abzughebel wird die Schlagbolzenmutter frei, die Feder entspannt sich und schnellt den Schlagbolzen vor. Dieser trifft auf das Zündhütchen, drückt gegen den Amboss der Zündglocke und entzündet dadurch den Zündsatz. Die Stichflamme des Zündsatzes wird durch die Zündkanäle in den Pulverraum der Patronen geleitet und bringt das Pulver zum Verbrennen. Beim Verbrennen des Pulvers entstehen Gase mit dem Bestreben sich auszudehnen. Durch den Verschluss und das Patronenlager seitwärts, oben und unten gehindert, suchen sie den Weg des geringsten Wiederstandes – nach vorne. Durch das Verdichten in der Patrone erhöht sich der Druck im Verbrennungsraum. Dadurch entsteht beim Austritt der Gase aus dem Lauf ein scharfer Knall. Im Augenblick dieses Vorganges entsteht ein Gasdruck von 2600 kg.
Zum Gewehr des Bürgerkorps
Das Präsentieren des Gewehrs und das Abschießen einer Ehrensalve ist die gardegemäße Form (wenn eine Kompanie auftritt) eines Ehrenerweises, eines Grußes auch an den Herrgott, dem wir begegnen in der Botschaft des Evangeliums, in der Eucharistie (daher vor der Liturgiereform auch eine Ehrensalve bei der Wandlung) und im Erweis seiner Gnade, seines Segens.
Das Abschießen der Ehrensalve ist ein altes Friedenssymbol. Es heißt: Für dich ist niemals eine Kugel im Lauf. Ich komme zu dir und will dir als Freund begegnen. Genauso wie das Salutieren bedeutet (es geht zurück auf das Hochschieben des Visiers des Reiters): Ich gebe mich dir zu erkennen, ich trete dir offen als Freund entgegen.